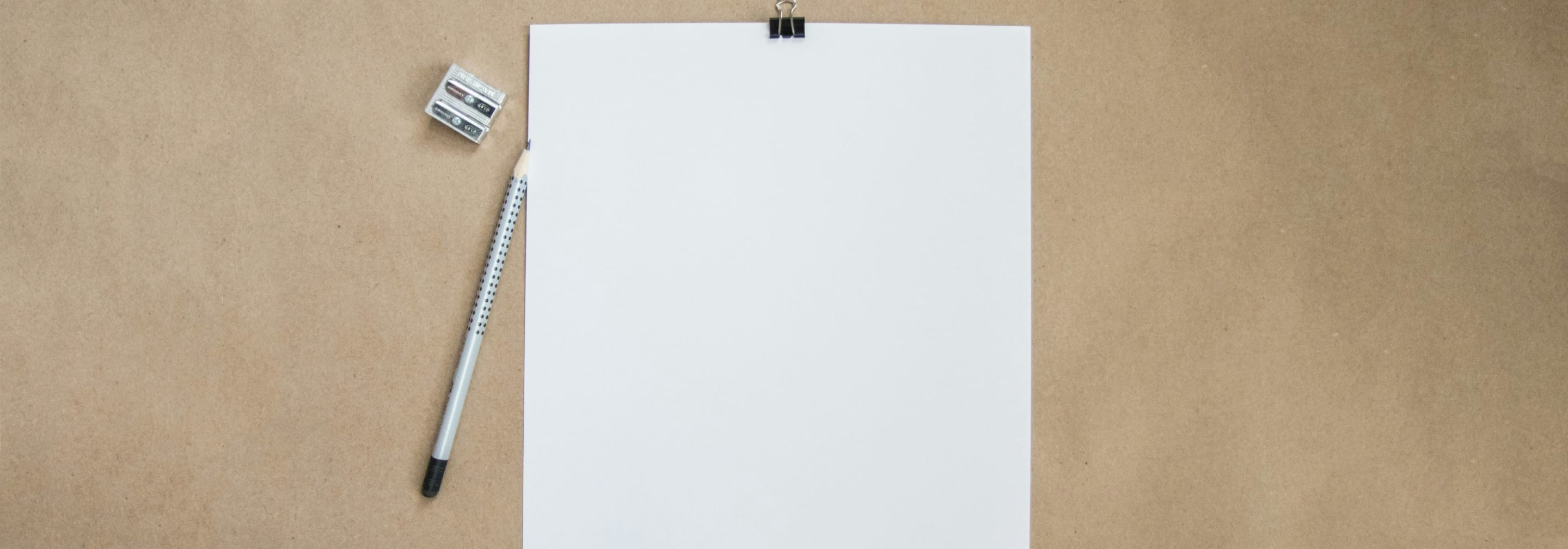Psychische Schlafstörungen behandeln: Ursachen verstehen & Hilfe finden

Eine einzelne schlechte Nacht erlebt jeder mal. Wer allerdings unter andauernden Schlafproblemen oder Tagesmüdigkeit leidet, beginnt früher oder später, sich folgendes zu fragen: Warum kann ich nicht mehr schlafen?
Schlafstörungen beeinträchtigen Gesundheit, Stimmung und Leistungsfähigkeit. Sie erhöhen das Risiko für chronische Krankheiten und verringern langfristig sowohl die Lebensqualität als auch die Lebenserwartung. Viele der betroffenen Menschen suchen die Ursache zunächst bei körperlichen Auslösern: Liegt ein Vitamin- oder Mineralstoffmangel vor? Sind die Hormone verantwortlich? Oder verbirgt sich hinter der Schlafstörung eine noch unbekannte körperliche Erkrankung? Was viele nicht wissen: Häufig sind psychische Prozesse der Auslöser für Schlaflosigkeit. In diesem Artikel erfährst du, wie du psychisch bedingte Schlafstörungen erkennst und welche Lösungswege es gibt.

Auswirkungen von Schlafmangel auf Körper und Psyche
Schlafmangel ist kein harmloses Alltagsphänomen. Er hat messbare Folgen für Körper und Psyche. Schon wenige Nächte mit zu wenig oder nicht erholsamem Schlaf können zu Konzentrationsproblemen, Müdigkeit, gereizter Stimmung, verminderter Leistungsfähigkeit führen. Auf der körperlichen Ebene spürt man brennende Augen, schwere Augenlider und Kopfschmerzen. Hält der Schlafmangel über längere Zeit an, steigt das Risiko für ernsthafte gesundheitliche Probleme deutlich an: Das Immunsystem wird geschwächt, Entzündungsprozesse im Körper nehmen zu und auch der Stoffwechsel gerät aus dem Gleichgewicht. Das kann langfristig Erkrankungen wie Übergewicht, Diabetes oder Bluthochdruck begünstigen.
Und auch die psychische Gesundheit leidet unter chronischem Schlafmangel. Studien zeigen, dass anhaltender Schlafmangel psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder auch Burnout bedingt.
Ausreichend guter Schlaf ist also nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit. Er ist eine zentrale Voraussetzung für körperliche Regeneration, seelische Stabilität und kognitive Leistungsfähigkeit. Wer an Schlafproblemen leidet, sollte deshalb handeln.

Erholsamer Schlafen

Stecken hinter meinen Schlafstörungen psychische Ursachen?
Ursachen?
Körperliche Ursachen wie Hormonstörungen, Mängel oder diverse andere Vorerkrankungen können zwar zu schlechtem Schlaf führen, die deutlich häufigeren Auslöser sind allerdings psychischer Natur. Die sogenannte „nicht-organische Insomnie“ macht den Großteil aller behandlungsbedürftigen Schlafstörungen aus.
Wenn du seit Wochen oder Monaten mit Schlafproblemen kämpfst und gleichzeitig unter Stress, emotionaler Belastung oder anderen psychischen Symptomen leidest, ist es wahrscheinlicher, dass deine Schlafstörung nicht organischer, sondern psychischer Natur ist.
Diagnose: psychische oder organische Schlafstörung?
In der Diagnose einer Schlafstörung wird zwischen organischen und nicht-organischen Schlafstörungen unterschieden. Das heißt, die Schlafstörung kann entweder physischer Natur sein, oder psychischer. Während sie von Einschlaf- über Durchschlafproblemen bis zum verfrühten morgendlichen Erwachen zwar zur selben Symptomatik führen, unterscheiden sie sich in ihren Ursachen. Wichtig zu verstehen ist also, dass die Symptomatik allein nur wenig Aufschluss über den Ursprung der Schlafstörung zulässt.
Bei der Diagnose einer psychischen Schlafstörung ist es deshalb wichtig, zunächst körperliche Ursachen wie Schlafapnoe oder das Restless-Legs-Syndrom (RLS) auszuschließen. Eine Schlafapnoe sorgt durch nächtliche Atemaussetzer zu stark verminderter Schlafqualität, während das RLS zu unangenehmen Empfindungen in den Beinen führt. Auch besondere Lebensphasen wie die Pubertät, eine Schwangerschaft oder die Wechseljahre sollten berücksichtigt werden. Durch hormonelle Veränderungen in diesen Lebensabschnitten kann es zu Schlafproblemen kommen, die aufgrund des physiologischen Ursprungs als organisch eingestuft werden. Vor allem Jugendliche und Frauen haben daher ein höheres Risiko, eine hormonell bedingte Schlafstörung zu entwickeln.
Deutet eine körperliche Untersuchung auf eine organische Ursache hin, sollte eine genaue Abklärung im Schlaflabor erfolgen. Für eine erste Einschätzung und Bewertung können Fragebögen zum Schlafverhalten hilfreich sein. Zusätzlich ist ein diagnostisches Gespräch mit Fachärzten oder einem Psychiater möglich.
Psychische Ursachen erkennen
Die folgende Checkliste hilft dir zu verstehen, ob es sich auch bei deinem Schlafproblem um eine nicht-organischen Insomnie handeln könnte:
Du leidest unter Ein- oder Durchschlafstörungen oder schlechter Schlafqualität
Die Probleme bestehen mindestens drei Mal pro Woche
seit einem Zeitraum von mindestens einem Monat
Du machst dir nachts oder sogar tagsüber viele Gedanken über deinen Schlaf und hast Angst vor den gesundheitlichen Folgen des Schlafmangels.
Dein Schlafproblem wirkt sich deutlich negativ auf deinen Alltag aus, zum Beispiel wenn du aufgrund des Schlafmangels schneller gereizt reagierst.
Wenn mehrere dieser Kriterien auf dich zutreffen, kann das ein erstes Zeichen sein, dass deine Schlafstörung psychisch bedingt ist. Für die Behandlung deiner Schlafstörung sind das gute Neuigkeiten. Liegt die Ursache in der Psyche, kann sich der Schlaf auch ohne die Einnahme von Medikamente und Schlafmittel dauerhaft verbessern lassen. Auch wenn eines der Diagnosekriterien die Mindestdauer von einem Monat ist, ist es für die erfolgreiche Behandlung einer Schlafstörung ratsam, so schnell wie möglich zu handeln. So kann eine Chronifizierung des Schlafproblems verhindert werden.
Voraussetzung dafür ist die Erkennung und gezielte Behebung der Ursachen. Die Bandbreite möglicher psychischer Ursachen ist groß. Oft bedingen sich verschiedene Faktoren dazu gegenseitig und greifen ineinander. Es lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf die häufigsten psychischen Auslöser.

Innere Unruhe und Schlafstörungen
Dafür, dass der Start in die Nacht gelingt, ist vor allem unser Entspannungslevel vor dem Einschlafen entscheidend. Um erholsam ein- und durchzuschlafen, sind sowohl die körperliche als auch die mentale Entspannung eine wichtige Voraussetzung. Der Prozess des mentalen zur Ruhe kommens funktioniert nicht durch das Umlegen eines Schalters. Das Gehirn benötigt ausreichend Zeit, die Eindrücke und Gedanken des Tages zu verarbeiten. Der Übergang vom aktiven Tagmodus in den abendlichen Ruhezustand ist deshalb ein Punkt, an dem für viele das Problem beginnt.
In unserem Alltag, der oft von Hektik und Leistungsdruck geprägt ist, rutscht dieses Zeitfenster für Entspannung am Abend auf der Prioritätenliste schnell nach unten. Die unverarbeiteten Eindrücke des Tages äußern sich dann in Form von kreisenden Gedanken, nächtlichem Grübeln, innerer Unruhe oder körperlicher Anspannung - die Folge sind Einschlaf- oder Durchschlafprobleme.

Schlafstörungen durch Stress
Stress zählt zu den häufigsten Auslösern psychischer Schlafstörungen. Grund dafür ist, dass die beeinträchtigende Wirkung von Stress nicht auf einen Wirkungsmechanismus begrenzt ist - er schadet unserem Schlaf auf verschiedenen Ebenen, durch denselben Mechanismus, durch den auch Burnout Schlafstörungen begünstigt.
Stress führt zum einen durch Termin- und Leistungsdruck zu den beschriebenen Problemen beim Abschalten, wenn sich Betroffene nicht mehr die nötige Zeit zum Abschalten vor dem Zubettgehen nehmen. Zusätzlich dazu hat Stress aber auch körperliche Auswirkungen. Bist du über einen andauernden Zeitraum gestresst, beginnt dein Körper, Cortisol auszuschütten. Der erhöhte Cortisolspiegel wirkt sich dann aktivierend auf dein Nervensystem aus. Es kann sein, dass du dich aufgekratzt fühlst, körperlich angespannt bist oder einfach nicht mehr schläfrig zu sein scheinst. Vor allem letzteres ist ein wichtiges Zeichen, die Schlafprobleme anzugehen.
Abgesehen davon ist das Hormon Cortisol auch an unserem Schlaf-Wach-Rhythmus, auch zirkadianer Rhythmus genannt, beteiligt. Ist unser Cortisol dysreguliert, kann das vor allem die Störung dieses körpereigenen Rhythmuses zur Folge haben. Zu den Einschlafstörungen gesellen sich dann in vielen Fällen auch Durchschlafprobleme oder Probleme des verfrühten Erwachens am Morgen. Auch der Versuch, am Wochenende den Schlaf nachzuholen, gelingt damit nicht.

Schlafstörungen aufgrund von psychischen Belastungen
Nicht nur beruflicher Stress, auch emotionale Belastungen und Lebenskrisen können zur Ursache eines Schlafproblems werden. Der Grund ist ähnlich wie bei beruflicher Belastung oder einem hektischen Lebensstil: auch starke negative Emotionen hindern dich in deiner Fähigkeit, zu entspannen und aktivieren dein Nervensystem. Dadurch gelingt es deinem Körper nicht, in den für den Schlaf notwendigen Ruhemodus zu gelangen.
Typische emotionale Belastungen, die Schlafstörungen auslösen können sind die folgenden:
- Familiäre Konflikte
- Finanzielle Sorgen
- Prüfungsängste
- Pflegesituationen
- Trauerfälle
- Partnerschaftskrisen
- Traumatische Erfahrungen
Schlafprobleme nach Trennung
Trennungen zählen zu einer der einschneidendsten Erlebnisse im Leben und stellen damit eine immense emotionale Belastung dar. Sie lösen nicht nur Gefühle von Traurigkeit aus, sondern bedeuten oft einen massiven Eingriff in den eigenen Selbstwert, das Selbstbild und den eigenen Lebensplan.
Trennt sich der Partner oder die Partnerin bedeutet das Zurückweisung, Verlust einer Bezugsperson und Kontrollverlust auf einmal. Diese Vielschichtigkeit von Trennungen kann ein seelisches Ungleichgewicht auslösen, welches dann auch den Schlaf ins Wanken bringt.
Folge sind nicht nur Probleme beim Abschalten und starkes Gedankenkreisen, oft geht mit dem Verlust einer Beziehung auch ein massives Stück an wahrgenommener Sicherheit verloren. Dieses unterbewusste Gefühl kann im Körper zu einer Stressreaktion führen, welches sich dann wie andere Arten von Stress schlafhindernd auswirkt.

Ich bin müde aber kann nicht schlafen
Depressionen sind oft mit schweren Schlafproblemen verbunden. Wenn Depressionen Schlafstörungen verursachen, handelt es sich meist um Ein- oder Durchschlafstörungen. In seltenen Fällen kann es auch zu einer sogenannten Hypersomnie kommen, einem übermäßigen Schlafbedürfnis.
Die Beziehung zwischen Depression und Schlafstörung ist dabei nicht einseitig. Studien zeigen, dass anhaltende Schlafprobleme auch das Risiko für die Entwicklung einer Depression deutlich erhöhen können. Schlafstörungen und Depressionen bedingen sich also gegenseitig. Deshalb gilt: Suche bei anhaltenden Schlafstörungen unbedingt nach Lösungen!

Die Angst nicht schlafen zu können
Auch Angststörungen stehen in enger Verbindung mit gestörtem Schlaf, wenn auch seltener als bei Depressionen. Teilweise haben Betroffene Angst vor dem Schlafen, zum Beispiel aufgrund von Alpträumen. Meistens geht es aber eher darum, dass sich Sorgen und Ängste verstärken, wenn man ohne weitere Ablenkung ruhig im Bett liegt. Finden Betroffene dann über längere Zeit nicht in den Schlaf, kann es darüber hinaus passieren, dass der Zustand des nicht Schlafens neue Ängste verursacht. Es entsteht ein Teufelskreis, der ohne Hilfe nur schwer zu durchbrechen ist. Hier gilt es dann vor allem, die Angst vor Schlaflosigkeit zu überwinden.
Heiße Nächte?
Cool bleiben

Was kann man gegen Schlafstörungen machen? Schlaftherapie nach der KVT-I
Den eigenen Schlafproblemen auf den Grund zu gehen, ist oft der entscheidende erste Schritt auf dem Weg zur Besserung. Wer versteht, welche inneren oder äußeren Faktoren den Schlaf beeinträchtigen. Im zweiten Schritt geht es darum, passende Unterstützung zu finden. Was hilft gegen Schlaflosigkeit?
Laut den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) ist die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I) die empfohlene Therapie der ersten Wahl bei einer nicht-organischen Insomnie. Die KVT-I wird damit Ansätzen mit Medikamenten, die potentiell zu Abhängigkeit oder Nebenwirkungen führen können, vorgezogen. Ihre Effektivität in der nachhaltigen Besserung von Schlafstörungen wird durch zahlreiche Studien unterstützt (Trauer et al., 2015; van Straten, 2018).
Zentraler Bestandteil der KVT-I sind kognitive Techniken, mit denen negative oder hinderliche Einstellungen und Gedankenmuster („Ich kann sowieso nicht schlafen“) erkannt und aufgelöst werden. Ziel ist es, dysfunktionale Überzeugungen durch realistischere und förderliche Gedanken zu ersetzen, die den Schlaf begünstigen.
Ergänzend dazu kommen verhaltensorientierte Methoden zum Einsatz, wie zum Beispiel die sogenannte Stimuluskontrolle, bei der die Assoziation zwischen dem Bett und dem Schlaf wiederhergestellt wird. Auch Maßnahmen zur Verbesserung der Schlafhygiene, also der schlaffördernden Gewohnheiten rund um den Schlaf, sind Teil dieser Arbeit. Denn oft sind es eigene Verhaltensweisen, die Schlafstörungen aufrechterhalten.
Abgerundet wird die KVT-I durch Entspannungstechniken und schlaffördernde Maßnahmen, etwa die Progressive Muskelrelaxation oder geführte Visualisierungen. Diese helfen, körperliche Anspannung zu reduzieren und das Nervensystem zu beruhigen.
Durch diese Kombination an Ansätzen bietet die KVT-I eine ganzheitliche Herangehensweise zur nachhaltigen Verbesserung des Schlafs, deren Effektivität in zahlreichen Studien nachgewiesen wurde. Die Dauer variiert meist von einigen Wochen bis zu einigen Monaten.

Schlafrestriktionstherapie
Ein erwähnenswerter spezieller Ansatz innerhalb der Verhaltenstherapie ist auch die sogenannte Schlafrestriktion. Hier wird nicht mit den Einstellungen zum Schlaf sondern lediglich auf der Verhaltensebene gearbeitet. Dabei wird die Zeit im Bett zunächst stark verkürzt, um den nächtlichen Schlafdruck aufzubauen und den körpereigenen Schlaf-Wach-Rhythmus wiederherzustellen. Die Schlafrestriktionstherapie ist durch das absichtlich herbeigeführte Schlafdefizit ein radikaler Schritt, der unter anderem mit viel Müdigkeit während des Tages verbunden ist. Er sollte deshalb nur unter Betreuung eines Experten oder einer Expertin durchgeführt werden.

Medikamentöse Behandlung bei Schlafstörungen?
Obwohl ein verhaltenstherapeutischer Ansatz eindeutig als „Mittel der ersten Wahl“ empfohlen wird, gibt es Situationen, in denen eine Behandlung mit der Einnahme von Medikamenten ratsam sind. In solchen Fällen sollte die Behandlung stets im engen Kontakt mit entsprechenden Fachärzten erfolgen, da viele verschreibungspflichtige Schlafmedikamente Nebenwirkungen haben und ein Abhängigkeitsrisiko bergen können.

Selbsthilfe bei Schlafproblemen: Schlaftracking & Schlafhygiene
Wer seinen Schlaf verbessern möchte, sollte zunächst Informationen sammeln, um ein realistisches Bild des eigenen Schlafes zu bekommen. Hier kann es helfen, ein eigenes Schlaftagebuch zu führen. Wichtige Daten, die du dokumentieren kannst, sind deine Bettzeit, deine Aufstehzeit sowie nächtliche Wachphasen. Daraus kannst du dann deine regelmäßige Schlafdauer errechnen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Stunden du regelmäßig schläfst. Die meisten Menschen benötigen zwischen 7 und 7,5 Stunden Schlaf, wobei die optimale Dauer von Mensch zu Mensch variiert. Darüber hinaus lohnt es sich auch zu dokumentieren, wie erholsam du deinen Schlaf subjektiv empfunden hast, wie aktiv du am vorherigen Tag warst und wie deine Stimmung war. Auch das körperliche Aktivitätslevel, dein Koffeinkonsum und der Konsum von Alkohol können hilfreich sein. So ist es möglich, Rückschlüsse darauf zu ziehen, welche deiner Verhaltensweisen für deinen Schlaf förderlich oder weniger förderlich sind. Die Daten kannst du ganz einfach jeden Morgen mit Stift und Papier oder in deinem Handy festhalten.
Um deinen Schlaf dann nicht nur zu verstehen, sondern auch zu verbessern, ist es wichtig, dass du eine gute Schlafhygiene einhältst. Die folgenden Tipps solltest du hierbei auf jeden Fall beachten:
Verzichte auf Koffein am Nachmittag
Dimme am Abend deine Lichter und benutze vor allem warmes Licht
Benutze bei Geräten mit Bildschirm am Abend einen Blaulichtfilter
Verzichte auf schwere Mahlzeiten, die zu nah an deiner Bettzeit sind
Darüber hinaus kannst du auch deine eigene Abendroutine entwickeln, bestehend aus ein bis drei Elementen, die dir helfen, zur Ruhe zu kommen. Wenn du zum grübeln neigst kann es dir zum Beispiel helfen, ein Grübeltagebuch zu führen. Wer körperlich angespannt ist, sollte auf körperliche Entspannungsübungen zurückgreifen. Eine solche regelmäßige Abendroutine hilft deinem Körper dabei, in den Entspannungsmodus zu wechseln. Durch gleichbleibende Abläufe verknüpft dein Gehirn bestimmte Handlungen automatisch mit dem bevorstehenden Schlaf. Das kann vor allem dabei helfen, schneller einzuschlafen.
Gängige Schlafmythen: Was solltest du lieber nicht probieren?
Abseits von hilfreichen Tipps zur Selbsthilfe kursieren auch zahlreiche Informationen zur eigenen Behandlung von Schlafproblemen, die auf Mythen basieren. Hier ist allerdings Vorsicht geboten.
Mythos Alkohol: „Ein Glas Wein hilft beim Einschlafen.”:
Zwar kann Alkohol zunächst entspannend wirken, stört jedoch die Schlafarchitektur erheblich und führt insgesamt zu einem unruhigen, nicht erholsamen Schlaf. Auch rezeptfreie Schlafmittel wie Antihistaminika werden anstelle von Schlafmitteln oft leichtsinnig eingesetzt, um sich die leichte schlaffördernde Wirkung zu Nutze zu machen. Ihre Wirkung ist allerdings kurzfristig, oberflächlich und kann zum Teil Abhängigkeit fördern. Die dauerhafte Lösung eines Schlafproblems gelingt damit deshalb nicht.
Mythos Schlaf nachholen: “Das Schlafdefizit, das ich über die Woche ansammle hole ich einfach am Wochenende nach."
Viele Menschen fragen sich, inwiefern sich fehlender Schlaf kompensieren lässt. Zwar lassen sich einzelne Nächte kompensieren, doch einen dauerhaft gestörten Schlafrhythmus kann man allein durch das Ausschlafen am Wochenende nicht ausgleichen. Entscheidend ist vielmehr eine langfristige Schlafroutine und die Arbeit an den Ursachen.
Mythos Mittagsschlaf: “Wenn ich in der Nacht schlecht geschlafen habe sollte ich mir tagsüber einen Mittagsschlaf gönnen.”:
Während ein kurzer Mittagsschlaf dir kurzfristig Energie geben kann, senkt er den Schlafdruck für die kommende Nacht ab. Wer also tagsüber schläft, riskiert es ind er Regel also, abends wieder schlecht einzuschlafen. Damit entsteht ein Teufelskreis, bei dem der Schlaf-Wach-Rhythmus mehr und mehr durcheinander kommt.
Wenn du selbst effektiv an deinem Schlafproblemen arbeiten möchtest konzentriere dich lieber auf die Etablierung einer dauerhaften guten Schlafhygiene, eines Schlafrituals und die Behebung der Ursachen, statt auf kurzlebige Schein-Lösungen, die das eigentliche Schlafproblem überdecken.
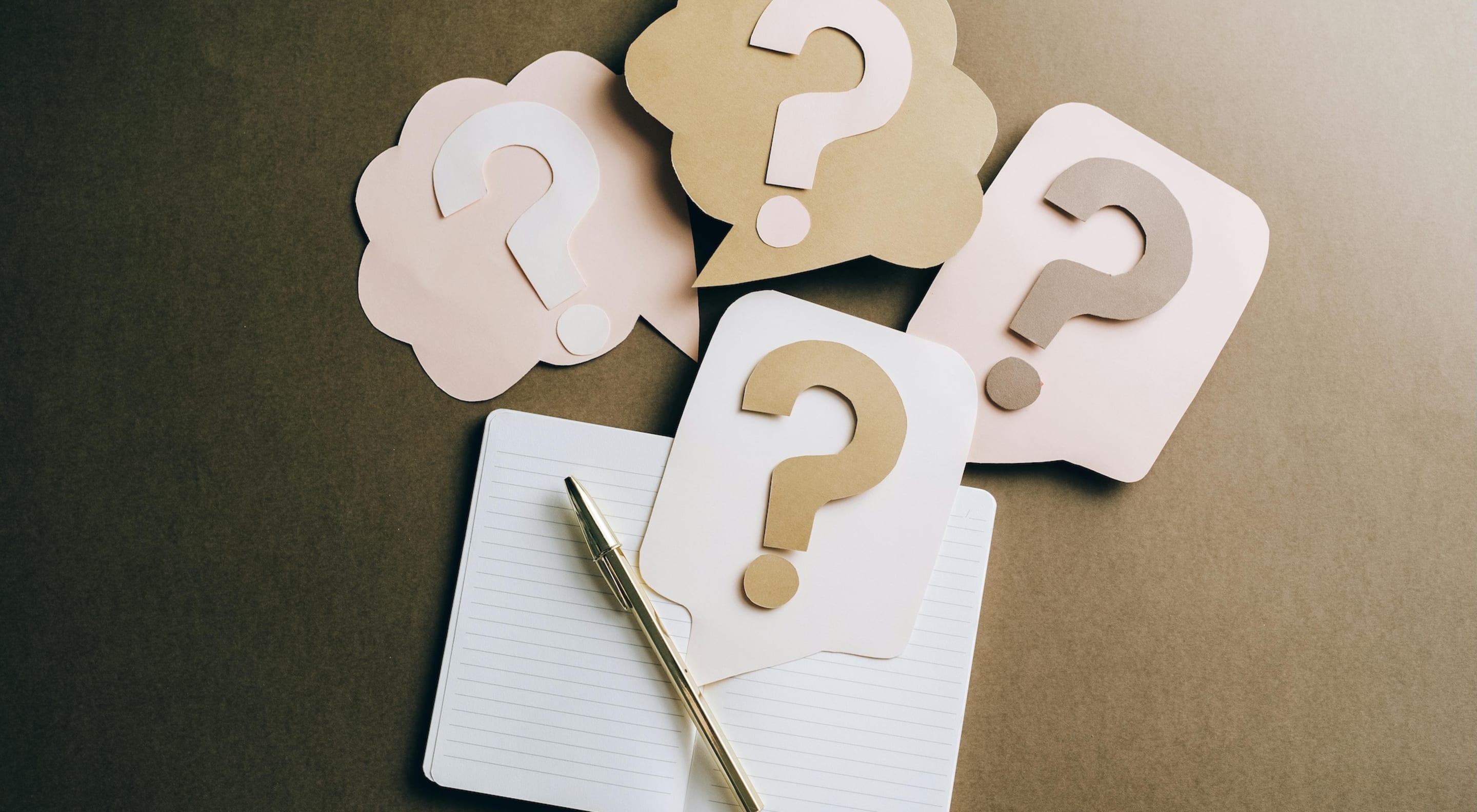
Hilfe bei Schlafstörungen: Wo findest du sie?
Wenn du dauerhaft an Schlafproblemen leidest, suche dir Hilfe von Experten. Der erste Schritt sollte immer der Kontakt mit dem Arzt, der Ärztin oder Schlafmediziner*innen sein, um körperliche Ursachen auszuschließen. Ergibt sich kein organischer Befund, bietet die KVT-I den besten Ansatzpunkt. Hier stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:
Schlaftherapeut, Psychotherapeut & Psychiater
Während eine Behandlung im Rahmen einer psychologische Psychotherapie vor Ort die erste Wahl darstellt, ist die Zugänglichkeit dieser Möglichkeit leider stark begrenzt. Zum einen können durch den aktuell in Deutschland herrschenden Psychotherapeutenmangel viele Therapeuten nur nach langer Wartezeit neue Patienten aufnehmen. Auf der anderen Seite sind Psychotherapeut*innen mit einer Spezialisierung auf die Thematik Schlaf für Viele leider nur schwer auffindbar. Sobald Medikamente Teil der Behandlung sind, ist ein Psychiater die richtige Adresse.
Online-Programme
Eine gute Alternative zu einer Behandlung vor Ort könnte deshalb eine KVT-I im Rahmen eines Online-Programms sein, vor allem, wenn sie eine persönliche psychologische Begleitung anbieten. Denn Studien haben belegt, dass Online-Programme vor allem dann zu einem großen Erfolg führen, wenn sie eine individuelle Betreuung anbieten. Die Dauer kann hier variieren, wobei in der Regel längere Programme zu besseren Erfolgen führen.
Diese digitalen Angebote haben oft eine niedrigere Eintrittshürde, sind flexibel in den Alltag integrierbar und ermöglichen intensive Betreuung, zum Teil sogar im täglichen Austausch via Chat.
Teilnehmende solcher Online-Programme[1] beschreiben ihre Erfahrungen wie folgt: “Die Verhaltenstherapie ist der Schlüssel im Umgang mit z.B. Angst, auch Schlafangst. Durch die Veränderung von negativen Gedanken, Entspannungsübungen, Achtsamkeit und Dankbarkeit kann man vieles in den Griff bekommen. Man muss sich aber auch darauf einlassen und üben. "Mir hat es sehr geholfen.”
Fachzentren, Schlaflabore und Psychiatrie
Gerade für eine Ersteinschätzung können sich Betroffene auch immer an schlafmedizinische oder psychologische Experten wenden. Bei der Feststellung einer psychischen Schlafstörung wird der Leitlinie entsprechend eine kognitive Verhaltenstherapie gegen Insomnie empfohlen.
Checkliste: Wann sollte ich wegen meiner Schlafprobleme meinen Arzt aufsuchen?
Wenn deine Schlafprobleme seit mehreren Wochen anhalten, ist ein Besuch bei deinem Arzt oder deiner Ärztin zur Prüfung möglicher organischer Auslöser in jedem Fall ratsam. Vor allem dann, wenn folgende Punkte zutreffen:
Wenn dir die Ursache deiner Schlafprobleme unbekannt ist.
Wenn du aufgrund anderer körperlicher Symptome eine organische Ursache vermutest.
Wenn du deine Schlafprobleme als große Belastung empfindest.
Wenn sich als Konsequenz der Schlafprobleme deine Stimmung zunehmend verschlechtert.
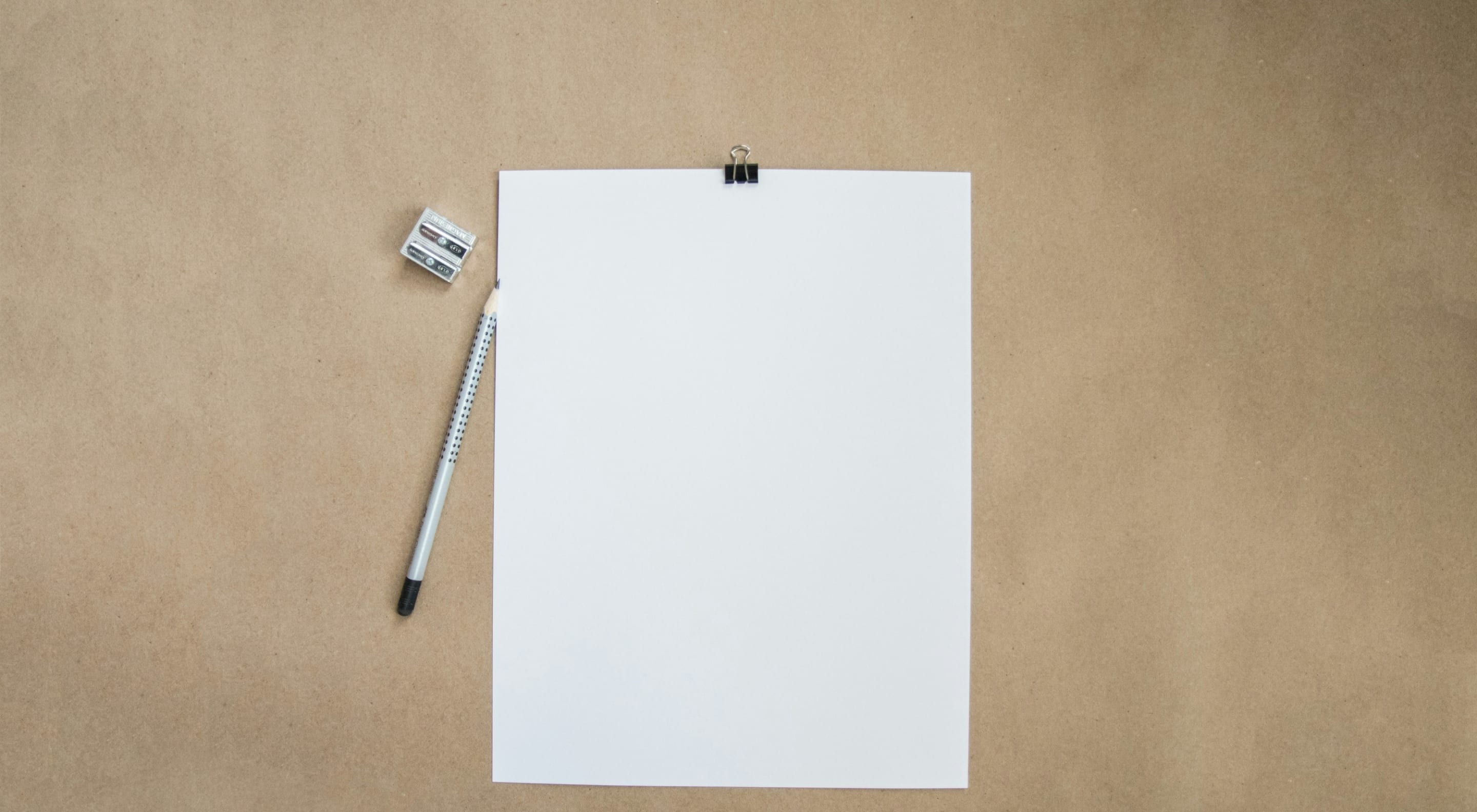
Fazit
Psychisch bedingte Schlafstörungen sind häufiger, als viele glauben - und sie bedeuten nicht automatisch eine psychische Erkrankung.
Entscheidend ist die individuelle Analyse deiner Situation, um die Ursachen hinter dem Schlafproblem zu verstehen. Die Kognitive Verhaltenstherapie (KVT-I) bietet die beste wissenschaftlich anerkannte Lösung, die nachweislich hilft. Vorausgesetzt, sie wird richtig angepasst. Daher ist eine persönlich abgestimmte Herangehensweise der Schlüssel zum Erfolg.
Eine psychische Schlafstörung ist also lösbar – mit dem richtigen Wissen, der passenden Methode und professioneller Begleitung.
Quellen & Studien:
Harvey, A. G. (2002). A cognitive model of insomnia. Behaviour Research and Therapy, 40(8), 869-893.